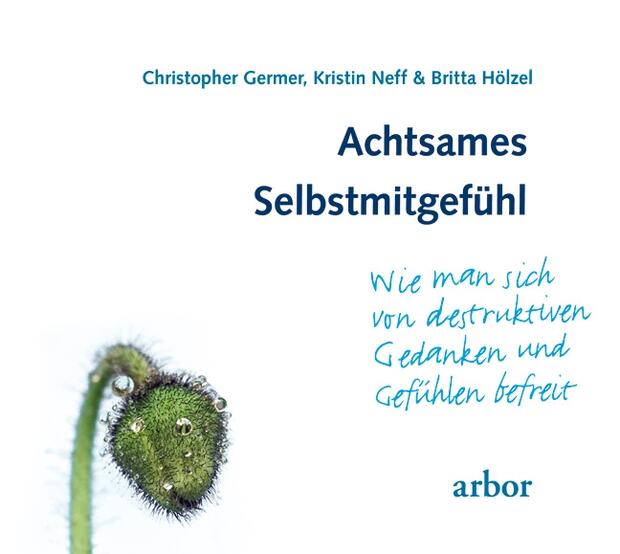Mitgefühl als Beruf
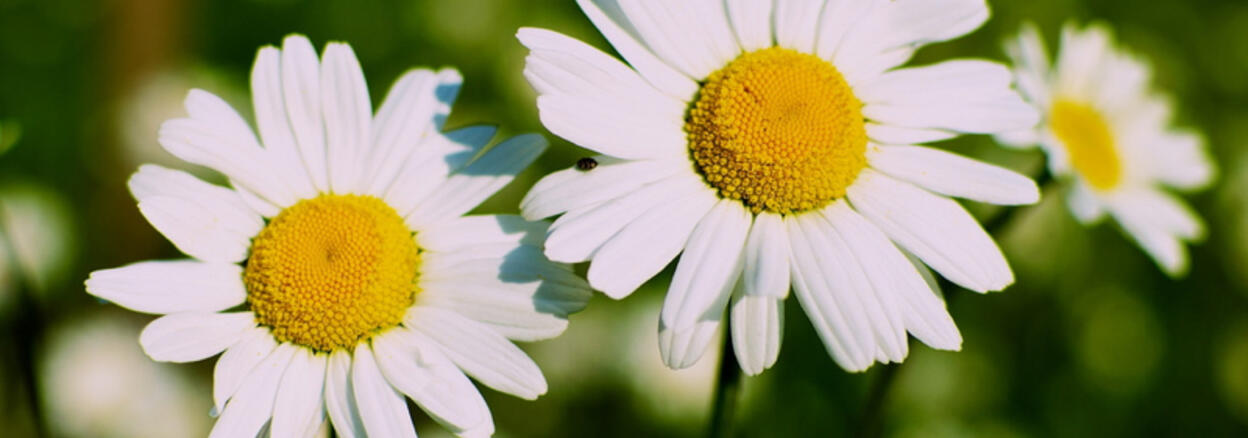
Mitgefühl als Beruf
„Das schwierige ist nicht einfach, Geld zu verdienen“, klagt der Sohn des schwerreichen Waffenfabrikanten Miguel Moliner in Juan Ruiz Zafóns Roman „Der Schatten des Windes“. „Das Schwierigste ist, es mit etwas zu verdienen, was es wert ist, dass man ihm sein Leben widmet.“ Und er fügt selbstkritisch hinzu: „Beim Arbeiten braucht man dem Leben nicht in die Augen zu schauen.“ Welchen Beruf wir wählen, hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Unser Beruf formt unsere Interessen und unseren Geist, beeinflusst stark unsere sozialen Beziehungen und die Gestaltung unserer Zeit.
„Übe keinen Beruf aus, der den Menschen und der Natur schadet. Investiere dein Geld nicht in Unternehmen, die anderen die Lebensmöglichkeiten rauben. Wähle einen Beruf, der hilft, dein Ideal des Mitgefühls zu verwirklichen.“ (aus: Vierzehn Regeln für alle, die auf dem Weg sind, von: Thich Nhat Hanh)
Einen helfenden Beruf auszuüben, ist ein Geschenk
Welchen Beruf wir ergreifen hängt vielleicht zum Teil von „Zufällen“ ab. Oder um es etwas genauer zu sagen: Es hängt von unserem „Karma“ ab. „Karma“ heißt auf Sanskrit einfach „Handlung“. Unser Leben, unsere Partnerwahl, die Wahl unseres Berufes sind z. B. bedingt durch die Handlungen unserer Vorfahren, durch unsere Erziehung, durch Schule, Vorbilder, Freunde, durch die Geschichte und Kultur des Landes, in dem wir leben. Wenn uns dieses „Karma“ einen sozialen Beruf beschert hat, können wir uns glücklich schätzen und dankbar sein.
Es ist nicht unser Verdienst, dass wir nicht töten müssen, um zu überleben, dass wir nicht in einem Unternehmen arbeiten müssen, das Waffen herstellt oder die Umwelt zerstört. Wenn wir einen helfenden Beruf ausüben können, ist das ein Geschenk und wir können lernen, es zu achten und zu schätzen, wenn wir über diese Zusammenhänge nachdenken. Wir vergleichen uns vielleicht mit anderen Menschen, die mehr verdienen, deren Status höher ist, deren Haus und Auto größer sind. Das kann uns neidisch und unzufrieden werden lassen und wir übersehen leicht die Chancen und Möglichkeiten, die uns unser Beruf schenkt. „Ist das, was ich tue, es wert, dass ich ihm mein Leben widme?“, können wir uns ab und zu fragen. Oder: „Dient mein Arbeiten dazu, dem Leben nicht in die Augen zu schauen?“
Tierpfleger oder Verhaltensforscher
Als Kind wollte ich am liebsten Tierpfleger werden. Oder Verhaltensforscher in Afrika. Nach der Schule habe ich dann zunächst eine Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung begonnen und Verwaltungswirtschaft studiert. Nach den Abschlussprüfungen fragte mich der Beamte des Innenministeriums, der die Prüfungsurkunden überreichte, was ich denn nun beruflich machen wolle. „Kommen Sie doch ins Innenministerium, Sie haben doch so einen hervorragenden Abschluss gemacht.“ Er konnte es überhaupt nicht verstehen, dass ich zunächst nicht in der Verwaltung arbeiten, sondern ein soziales Jahr in einem Kinderheim machen wollte. „Sie werden Ihr ganzes Leben lang im Besoldungsdienstalter ein Jahr hinter Ihren Kollegen herhinken.“, sagte er fast entsetzt.
Die Erfahrungen, die ich dann in dem Heim für „schwer erziehbare Kinder und Jugendliche“ machte, waren teilweise schrecklich. Aber trotzdem wollte ich nicht zurückgehen aufs Rathaus oder ins Landratsamt. Als ich dann auch noch beschloss, anschließend Sozialarbeit zu studieren, war auch mein ehemaliger Ausbildungsleiter auf dem Rathaus völlig fassungslos. „Das bringt dich keine Gehaltsstufe weiter. Im Gegenteil: Es mindert deine Aufstiegschancen!“ Trotzdem habe ich diese Entscheidung nie bereut.
Manchmal bin ich im Stillen dankbar für meinen Beruf als „Helfer“. Er integriert auch meine Kindheitsträume, habe ich irgendwann überrascht erkannt. Ich „pflege“ nicht Tiere, sondern Menschen. Ich erforsche nicht Zebras oder Schimpansen, sondern das Zusammenleben und die sozialen Probleme von Menschen. Und wenn ich mir wieder einmal die Frage stelle: „Was würde ich machen, wenn ich noch einmal von vorn beginnen könnte?“, dann komme ich jedes Mal zu dem Schluss: „Ich würde genau dasselbe wieder machen.“ Helfen ist ein schöner, großartiger Beruf, der Spaß macht und Befriedigung bringt. Das zu schreiben fällt mir nicht leicht. Es klingt irgendwie pathetisch und nach Helfersyndrom.
Wir Helfer haben das Privileg uns selbst zu begegnen
Aber für mich ist es tatsächlich immer noch ein großes Geschenk, in unserer Welt, die beherrscht ist vom „Evangelium des freien Marktes“, vom Diktat der Ökonomie, von Konkurrenz und dem Streben nach Profit, einen Beruf ausüben zu dürfen, in dem es möglich ist, Mitgefühl zu praktizieren. Das gilt trotz der häufig schlechten Rahmenbedingungen, die ich selbst nur allzu gut kenne.
„Wir Helfer und Helferinnen werden vielleicht schlecht bezahlt, aber wir haben das Privileg, in unserer Arbeit nicht nur anderen, sondern auch uns selbst zu begegnen, zu wachsen und zu reifen.“ Das sage ich manchmal meinen Studentinnen und Studenten oder Weiterbildungsteilnehmer(n)/innen. Aber nur leise, denn es passt so gar nicht in unsere Landschaft, in der professionelle Standeskämpfe, Abgrenzungsrituale und die Suche nach der eigenen „Domäne“ die helfenden Berufe eher zersplittert als eint, in der tatsächlich die Bezahlung teilweise skandalös schlecht ist und in der Wolfgang Schmidbauers – wichtige und hilfreiche – Arbeit zur Hilflosigkeit der Helfer jedes Reden von Mitgefühl und Barmherzigkeit bereits im Ansatz verdächtig macht.
Natürlich ist „Helfen“ nicht der einzige Beruf, in dem es möglich ist, Mitgefühl zu praktizieren. Die Bäuerin auf dem Markt, bei der ich das Gemüse kaufe, oder der freundliche Postbeamte, bei dem ich früher mein Geld noch persönlich abholte, strahlen durch ihr Lächeln, ihre Präsenz und ihre Geistes-Gegenwart ebenfalls Liebe und Mitgefühl aus. Aber in helfenden Berufen ist das vielleicht (noch) ein wenig leichter als in anderen.
In Wirklichkeit ist da keiner, der hilft und niemand, dem geholfen wird
Aber wir sind als Helfer oder Helferin nicht Expertinnen bzw. Experten, die alles wissen und können, sondern wir wissen – trotz und mit unserer Ausbildung, unseres Wissens, unserer Professionalität – nicht mehr als die Klientin oder der Patient von dem, was wirklich wichtig ist im Leben. Wir sind genauso wie sie betroffen von Alter, Krankheit, Trauer und Tod. Wir müssen sterben und eines Tages alles loslassen, was uns lieb und teuer ist. Insofern unterscheidet uns nichts Wesentliches von den Menschen, denen wir helfen. In Wirklichkeit ist da keiner, der hilft, und niemand, dem geholfen wird.
Die Übung der Fünf Betrachtungen kann hilfreich sein, sich diese Tatsache immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Thich Nhat Hanh hat diese uralte Praxis in eine wundervolle Form gebracht. Er empfiehlt, sie täglich zu rezitieren.
Die Fünf Betrachtungen
- Einatmend weiß ich, dass ich einatme.
- Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme.
- Einatmend weiß ich, dass ich alt werde.
- Ausatmend weiß ich, dass ich dem Alter nicht entkomme.
- Einatmend weiß ich, dass ich krank werde.
- Ausatmend weiß ich, dass ich Krankheiten nicht entkomme.
- Einatmend weiß ich, dass ich sterben muss.
- Ausatmend weiß ich, dass ich dem Tod nicht entkomme.
- Einatmend weiß ich, dass ich eines Tages alles aufgeben muss, was mir lieb und teuer ist.
- Ausatmend weiß ich, dass ich der Aufgabe aller Dinge,die mir lieb und teuer sind, nicht entkomme.
- Einatmend weiß ich, dass meine Handlungen mein einziges Eigentum sind.
- Ausatmend weiß ich, dass ich den Folgen meiner Handlungen nicht entkomme.
- Einatmend bin ich entschlossen, meine Tage in tiefer Achtsamkeit zu leben.
- Ausatmend sehe ich die Freude und den Frieden eines achtsamen Lebens.
- Einatmend weiß ich, dass ich einatme.
- Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme.
Diese Sätze erscheinen vielleicht manchem zunächst als „morbide“ und unnötig. Wissen wir nicht sowieso, dass wir krank werden? Können wir nicht etwas tun, dass wir gesund bleiben? Wir können die Wirkung ausprobieren. Vielleicht ist sie tatsächlich heilsam?
Seit ich die Fünf Betrachtungen am Morgen nach den Körperübungen für mich rezitiere, sind sie für mich zu einem kostbaren Juwel geworden. Ich empfinde tiefe Freude, wenn ich den Text spreche. Und ich erlebe es tatsächlich so, wie Thich Nhat Hanh sagt: Mit der Zeit schmelzen die fünf Grundängste langsam. Sie sind nicht weg, sie gehören zum menschlichen Leben, aber sie halten mich nicht mehr gefangen, ich bin ihnen nicht ausgeliefert und ich muss mein Leben nicht damit verbringen, vergeblich vor ihnen davonzulaufen.
Dieser Artikel stammt aus dem Buch Achtsamkeit in der Kunst des (Nicht) Helfens.