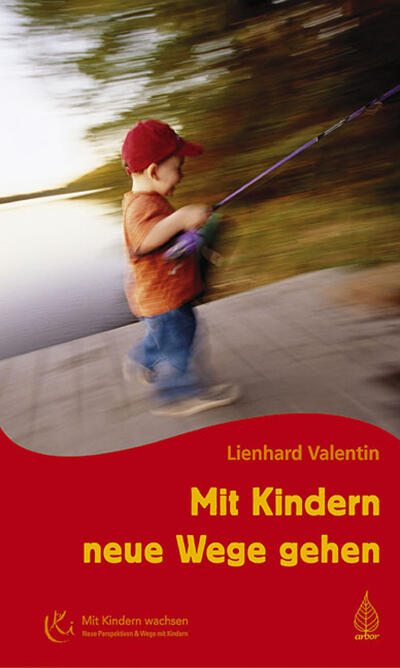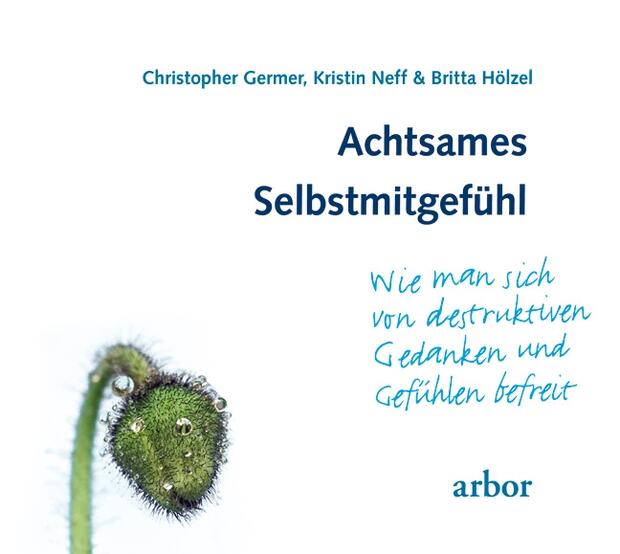Die Kraft des Selbstmitgefühls

Die Kraft des Selbstmitgefühls
Es gibt in unserer Kultur etwas, das uns schon fast wie eine Art Volksseuche oder eine Art böser Fluch verfolgt. Nein, ich rede jetzt nicht über Corona oder andere Krankheiten. Ich meine das Gefühl oder zumindest die dunkle Ahnung, nicht gut genug zu sein. Es verfolgt sehr viele Menschen wie ein Schatten und zaubert uns Stimmen in den Kopf, die uns ständig Geschichten darüber erzählen, dass wir nicht genügen, oder die uns ständig antreiben und uns keine Pause gönnen. Da gibt es perfektionistische Stimmen, die extrem hohe, letztlich unerfüllbare Erwartungen an uns stellen, sei es an unser Aussehen oder unsere Leistungen, oder kritische Stimmen, denen wir es nicht recht machen können und die uns ständig wissen lassen, dass wir so, wie wir sind, nicht liebenswert sind und keinerlei Wertschätzung verdienen. Und natürlich sollen wir uns gefälligst mehr anstrengen, mehr Sport treiben, mehr meditieren, gesünder essen und und und. Aber egal, was wir tun – diese Stimmen geben selten Ruhe.
Ganz oft empfinden Eltern dieses Gefühl, das wie ein Schatten ihren besten Vorsätzen und Anstrengungen folgt, möglichst perfekte Eltern für ihre Kinder zu sein. Mit ganzer Kraft wollen sie sich ihrer Verantwortung stellen und die besten Eltern der Welt sein – und auf jeden Fall unvergleichlich besser als ihre eigenen Eltern.
Besondere Macht haben diese Stimmen über uns, weil sie meist im Dunkeln wirken. Sie sind uns schon so vertraut, dass wir sie gar nicht bewusst wahrnehmen, sondern ihnen automatisch Gehör schenken und die Geschichten glauben, die sie über uns erzählen. Besonders deutlich hören wir diese Stimmen, wenn uns ein Missgeschick passiert ist, uns etwas danebengegangen ist oder wir etwas getan oder nicht getan haben, was uns hinterher peinlich ist oder leidtut. Ups, wir haben das Kind ausgeschimpft, oder wir sind extrem gestresst oder blockiert, wenn wir uns vor einer Gruppe äußern, eine kleine Ansprache halten sollen oder eine Prüfung absolvieren müssen.
Stell dir vor…
An dieser Stelle möchte ich dich zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen: Stell dir vor, du triffst eine gute Freundin oder einen guten Freund und diese Person erzählt dir zerknirscht von einem Missgeschick. Es kann sein, dass sie in einer Besprechung etwas in ihren Augen Dummes gesagt hat, dass sie in einer Stresssituation einen geliebten Menschen angefahren hat, ihr ein Lapsus an ihrem Arbeitsplatz oder etwas anderes Peinliches widerfahren ist. Nun stell dir vor, was du zu dieser Person, die dir am Herzen liegt, vielleicht sagen würdest. Wie wäre dein Tonfall? Würdest du sie eher trösten oder kritisieren?
Es reicht, wenn du einen Eindruck davon bekommst, wie du auf diese Person eingehen würdest. Und dann stelle dir vor, dir selbst wäre so etwas geschehen. Was würdest du vermutlich zu dir selbst sagen? Wie wäre da dein Tonfall? Gibt es einen Unterschied, wie du auf eine nahe Freund*in oder auf dich selbst eingehst?
Sich selbst eine gute Freundin werden
Wenn ich diese Frage in einem Vortrag oder Seminar stelle, sind fast alle deutlich härter mit sich selbst. Das ist doch interessant! Warum sind wir uns selbst gegenüber nicht ähnlich wohlwollend und mitfühlend wie einer guten Freundin oder einem guten Freund gegenüber? Und die vielleicht noch wichtigere Frage: Können wir daran etwas ändern und freundlicher werden mit uns selbst?
Die gute Nachricht lautet, dass dies durchaus möglich ist, und die Praxis der Achtsamkeit, des Selbstmitgefühls und der Selbsterforschung zeigt Wege auf, wie du dir selbst eine gute Freundin oder ein guter Freund werden kannst. Das geht nicht von heute auf morgen, es ist vielmehr eine Reise zu dir selbst und dazu, deine einzigartigen menschlichen Qualitäten zum Erblühen zu bringen. Zur Veranschaulichung kann besonders die Metapher des inneren Gartens dienen, denn letztlich geht es um Wachstums- und Entfaltungsprozesse, und vor diesem Hintergrund kann uns die Natur in mancherlei Hinsicht die Augen öffnen. Wie wir manche Pflanzen als Unkraut bezeichnen und aus unserem Garten verbannen wollen, so würden wohl die meisten von uns auch ihren inneren Kritiker, Antreiber oder Perfektionisten am liebsten aus ihrem inneren Garten verbannen. Oder wir glauben den kritischen Stimmen und verfallen in die mehr oder weniger subtile Aggression der Selbstverbesserung und wollen Seiten von uns loswerden, die uns nicht gefallen. Als Eltern sind das oft die Eigenschaften, die wir keinesfalls an unsere Kinder weitergeben möchten, aber selbst scheinbar nicht loswerden können.
Unser innerer Garten
Wenn wir stattdessen beginnen, uns für diese ungeliebten Pflanzen zu interessieren, um sie dann mit der Zeit besser zu verstehen, können wir ihnen schließlich einen Platz in unserem Garten geben, und dann können sie uns vielleicht als schmackhafte Kräuter oder sogar als Heilpflanzen dienen. Ganz ähnlich sieht es mit unserem inneren Garten aus. Auch in uns gibt es Aspekte unserer Persönlichkeit, die wir nicht mögen und am liebsten loswerden würden. Und auch hier gilt, dass diese Aspekte sich verwandeln können und uns wertvolle Dienste leisten, wenn sie ihren Platz in unserem inneren System gefunden haben. Aber wie genau kann dies geschehen? Die wichtigste Voraussetzung ist, dass wir anfangen, neugieriger für unsere verschiedenen Persönlichkeitsanteile zu werden, statt ständig mit uns selbst im Kampf zu liegen.
Im Englischen gibt es das treffende Wortspiel: „What you resist persists“ – frei übersetzt bedeutet das, dass alles, was wir bekämpfen, dem wir Widerstand leisten, nur noch beharrlicher bestehen bleibt. Auf der anderen Seite besagt das sogenannte Paradox der Veränderung, dass sich alles, was wir zunächst einmal so annehmen können, wie es ist, sich aus sich heraus verändert. Dabei bedeutet „annehmen“ oder „akzeptieren“ nicht, dass wir etwas gutheißen oder okay finden müssen – es gibt Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind. Vielmehr geht es darum, die aktuelle Wahrheit einer Situation oder Gegebenheit anzuerkennen. Dies ist alles andere als leicht, denn es widerspricht unserer natürlichen Tendenz, uns von allem abzuwenden, was unangenehm ist oder was wir nicht mögen.
Genau an dieser Stelle kommt die Praxis der Achtsamkeit ins Spiel. Genau genommen ist das deutsche Wort „Achtsamkeit“ irreführend, da es suggeriert, dass wir uns konzentrieren, uns anstrengen, etwas „tun“ müssten. Aber Achtsamkeit ist ein „Seinsmodus“ oder, wie es der Neurowissenschaftler Daniel Siegel ausdrückt, „der empfängliche Modus des Gehirns“. Das heißt letztlich, dass wir Achtsamkeit nicht tun können, wir können sie nicht mit unsrem Willen erzwingen. Es geht vielmehr darum, uns zu öffnen, empfänglich zu werden und unsere Erfahrung in einem offenen, interessierten und wohlwollenden Gewahrsein zu halten, ohne gleich etwas verändern oder verbessern zu wollen. Auf diese Weise weitet sich unser innerer Raum, wir bekommen eine weitere Perspektive und gewinnen so an innerer Freiheit, eine weisere Wahl zu treffen, was gegebenenfalls zu tun ist.
Meditation als einen Akt der Liebe
Für die Praxis der Achtsamkeit braucht es vor allem zwei Zutaten: Freundlichkeit oder Wohlwollen und Interesse oder Neugier. Wir üben uns darin, uns selbst und unserem Geist mit einem möglichst wohlwollenden Interesse zuzuwenden – und dies schließt auch die Aspekte unserer Persönlichkeit und unserer Erfahrung mit ein, die wir nicht mögen oder sogar nicht ausstehen können. Was dies für die meditative Praxis bedeutet, verdeutlichen auf wunderbare Weise die folgenden Worte des australischen Meditationslehrers Bob Sharples:
„Meditiere nicht, um Dich zu reparieren, zu heilen, zu verbessern, zu erlösen; tue es lieber aus einem Akt der Liebe heraus, aus tiefer, herzlicher Freundschaft Dir selbst gegenüber.“
Auf diese Art und Weise gibt es keinen Grund mehr, für die subtile Aggression der Selbstverbesserung, für die endlosen Schuldgefühle, nicht genug zu sein.
Es bietet Gelegenheit für ein Ende der unaufhörlichen Runden des schweren Versuchens, welches so viele Leben verhärtet. Stattdessen gibt es Meditation als einen Akt der Liebe. Wie unendlich wonnevoll und ermutigend.
Dieser Text ist erschienen in der Zeitschrift „Mit Kindern wachsen“, Ausgabe: Heft Januar 2023.